
Wer von Anstand und Tugenden spricht, outet sich als konservativ, altmodisch oder gar „rechts“. Darum kümmert sich Alexander von Schönburg zu Recht um das Thema.
Wer heute, außerhalb der Kirche, von Tugenden spricht, für den geht es vielleicht um Fleiß, für manche noch um Höflichkeit; damit hat es sich dann aber meistens auch schon. Dem Begriff Tugend haftet etwas Altmodisches an, genau wie dem Begriff Anstand. Wer heute zu Anstand auffordert, tut das im politischen Raum „Gegen Rechts“, obwohl der Ruf danach, anständig zu sein, eher konservativ, vielleicht in sich – nach politischem Neusprech – „rechts“ erscheint. Und weil das so ist, werden Anstand und Tugenden, in gewisser Weise zwei Seiten der gleichen Medaille, nicht eben hoch geschätzt. In den Sprachschatz finden sie nur Eingang, wenn es dem Einzelnen gerade opportun erscheint, mehr als Anspruch gegen Andere, vor allem den (politischen) Gegner, als gegen sich selbst.
Keuschheit, Gehorsam, Maß und Zucht
Da ist es verdienstvoll ein Buch zu schreiben über eben jenes Thema, Anstand und Tugenden ins heute zu übersetzen und den Staub abzuwischen, den die Begriffe in unserer Wahrnehmung angesetzt haben. Alexander von Schönburg, selbst Mitglied alten Adelsgeschlechts, dekliniert in seinem aktuellen Buch die „Kunst des lässigen Anstands – 27 altmodische Tugenden für heute“ durch. Man erkennt dabei schon, dass es nicht nur um christliche Tugenden geht, von Schönburg fasst den Begriff weiter und benutzt dabei – vielleicht auch ein bisschen um zu provozieren – ein Vokabular, das aus der Zeit gefallen zu sein scheinen: Keuschheit, Gehorsam, Maß und Zucht müssen viele heute bei Wikipedia nachschlagen, weshalb sie im Buch auch beispielhaft erläutert werden. Es ist eben in einer Zeit von „one-click-shopping“ nicht mehr selbstverständlich, Verzicht zu üben, geschweige denn, dass der Verzicht auf ein sich bietendes sexuelles Abenteuer noch wertgeschätzt würde.
Zum Glück erliegt von Schönburg dabei aber nicht der Versuchung des erhobenen Zeigefingers, sondern macht mehrfach auf den „Anspruchscharakter“ der Tugenden aufmerksam, an dem er selbst, wie er schreibt, allzu oft scheitert. Man kann nun auch in einer Rezension kaum alle beschriebenen Tugenden durchgehen, daher habe ich mir zwei herausgepickt, deren Beschreibung ich für besonders notwendig und – aber das ist eine Geschmacksfrage – im Buch besonders gelungen halte: Treue und Toleranz
Treue
Durch das Buch ziehen sich die Tugenden auch als Zeichen der Ritterlichkeit und so beschreibt von Schönburg die Tugend der Treue auch am Beispiel – wenngleich mit dem Hinweis des Scheiterns – des Ritters „Tristan“ (ja genau, der aus „Tristan und Isolde“). Das liest sich interessant, für spannender halte ich aber die bereits zum Einstieg herausfordernde Feststellung, angelehnt an Kierkegaard, dass es um eine Verpflichtung zur Liebe geht, die, einmal akzeptiert, diese erst richtig frei macht. Er zitiert: „Nur wenn es Pflicht ist, zu lieben, nur dann ist die Liebe gegen jegliche Verunsicherung ewig gesichert, ewig freigemacht in seliger Unabhängigkeit, gegen Verzweiflung ewig glücklich gesichert.“
Treue beschreibt denn auch Kierkegaard mit den Worten: „Wenn zwei Menschen einander nicht auf ewig lieben wollen, dann ist ihre Liebe nicht wert, dass man über sie spricht, geschweige denn, dass man über sie singt.“ Das allerdings sehen die meisten heute anders. Von Schönburg: „Der moderne Mensch kann kein ‚Sollen‘ und ‚Müssen‘ mehr ertragen und glaubt, sich durch die Befreiung davon einen Dienst zu erweisen, sieht aber nicht, dass er damit seine Würde untergräbt. […] Gescheiterte Beziehungen, Ehebruch, Fremdgehen, Untreue hat es immer gegeben. Aber was ist in uns gefahren, dass wir dieses Faktum, statt es zu bedauern, nun als Standard hinnehmen?“
Treue – wie jede Tugend – eine Zumutung
Interessanterweise ist den meisten durchaus instinktiv klar, dass mit einer solchen Einstellung, die letztlich darin fußt, dem Glück einer Beziehung in Treue zu misstrauen und sich nicht festlegen zu wollen auf einen zu liebenden Menschen, kein Glück verspricht. Niemand nimmt wirklich an, dass „Serienmonogamität“ zur Erfüllung in den Beziehungen und im Leben führt. Und trotzdem erscheint uns – wie bei den meisten Tugenden – der Anspruch der Treue als Zumutung, obwohl sie eine Tugend ist, die in Beziehungsdingen die einzige ist, die Erfüllung geben kann.
Wie es von Schönburg in seinem Fazit feststellt: „Ist Treue eine Zumutung? Natürlich! Aber nicht einmal tausend One-Night-Stands können sich mit dem Feuer messen, dass dadurch in eine Beziehung kommt. Die Wirkung des Verliebtseins lässt zwar nach, aber was danach kommt, ist noch viel begehrenswerter.“
Toleranz
Man könnte meinen, dass die Tugend der Toleranz in unserer Gesellschaft nun wirklich bis zum Erbrechen bemüht wird. Toleranz wird für alles und jedes – abgesehen von christlichen oder gar katholischen Glaubensüberzeugungen – gefordert; es scheint, an dieser Tugend dürfte es doch nicht mangeln, oder doch? In Wahrheit ist es mit der Toleranz (abgeleitet aus lat. tolerare = erdulden) nicht weit her. Denn anders als es – vielleicht, manchmal verklärt sich die Vergangenheit ja auch – früher, werden heute Streitigkeiten, gerade im politischen Umfeld, quasi bis auf’s Blut ausgetragen. Der Gegner wird nicht mit Argumenten bearbeitet, der Andersdenkende wird – gesellschaftlich, manchmal auch beruflich und finanziell – vernichtet.
Dabei bedeutet Toleranz als ritterliche Tugend auch, den anderen zu ehren. „Wer seinen Gegner nicht ehrt, hat selbst keine Ehre.“ Von Schönburg beschreibt das an einem Beispiel, das ihn offenbar selbst herausfordert: die Diskussion mit Gender- oder LGBT-Aktivisten: „Wenn ich mich möglichst schnell darauf besinne, dass auch sie/er/x ein Geschöpf Gottes ist, das von Ihm geliebt wird, habe ich die Chance, einen Gang zurückzuschalten, ihr/ihm/x mit Respekt zu begegnen, statt ihr/ihm/x an die Gurgel zu wollen. […] Man kann die Würde und Kostbarkeit in jedem sehen, auch in Claudia Roth, Jutta von Ditfurth, Pfarrer Fliege, jedem.“
Auch Toleranz ist eine Zumutung
Die Aufzählung macht erfrischend deutlich, wie schwer es uns – und beispielhaft dem Autor – fällt, diese Tugend der Toleranz zu leben. Toleranz ist einfach, wenn wir in etwa gleich ticken, Toleranz, in dem Sinne die „Ehre“, letztlich die Gottebenbildlichkeit des Gegners immer und überall zu würdigen, wird wiederum zu einer Zumutung, wenn es um die geht, bei denen ich sicher bin, dass sie falsch liegen oder überzeugt, dass sie Finsteres im Schilde führen. Dabei geht es nicht darum, dem Disput aus dem Weg zu gehen: Der „Allesversteher“ ist nur eine Karikatur von Toleranz.
„Es muss gezankt werden! Es muss knallen! Aber eben auf zivile Weise.“ Oder, wie es von Schönburg anhand des britischen Unterhauses beschreibt: „Man bewirft sich mit Gülle – aber danach findet es jeder normal, dass die, die sich gerade noch bekämpft haben, in der Bar des Unterhauses gemeinsam Gin Tonic trinken. Das hat Stil. Nicht unser ‚Mit dem kann ich nicht reden‘-Spießertum.“
Ritterlichkeit
Ist, der Gedanke kam mir bei der Lektüre, Alexander von Schönburgs „Die Kunst des lässigen Anstands“ ein Pendant, vielleicht ein weltliches, wenn auch mit erkennbar christlichen Farbtupfern, zur „Benedikt-Option“? Man könnte es so sehen, auch wenn dieses Buch weit weniger radikal in seinen Formulierungen daherkommt. Von Schönburg steht in der Welt, und er will sie auch gar nicht zu Gunsten einer gesicherten Nische verlassen. Aber der Entwurf, den er beschreibt, wenn man sich denn alle beschriebenen Tugenden zu eigen machen will, in ihnen üben und es in ihnen soweit wie möglich bringen will, ist nicht weniger radikal. Nach allem, was ich von Rod Dreher, dem Autor der „Benedikt-Option“ gehört habe, ist er ein durchaus humorvoller Mensch, das sieht man seinem Buch allerdings in weiten Teilen nicht an. Von Schönburg beschreibt die notwendigen Tugenden mit einer weitaus größeren – schon im Titel genannten – Lässigkeit, aber nicht mit weniger Anspruch.
Was einem besser gefällt, ist sicher auch Geschmacksache, aber vielleicht ist „Die Kunst des lässigen Anstands“ tatsächlich die „Benedikt-Option“ für denjenigen, der mit den benediktinischen Regeln oder mit dem christlichen Glauben (noch) nicht so viel anfangen kann, der aber ein Gespür dafür entwickelt hat, dass in unsere Welt Grundlegenderes schiefläuft als politische Dispute und überall diskutierte Probleme. Derjenige mag – statt auf den verbrannten Begriff der Tugenden – dann auf die „Ritterlichkeit“ setzen, von der von Schönburg am Ende schreibt: Vielleicht war Rittertum, auch in der Epoche seiner angeblichen Glanzzeit, immer nur eine Idee – eine Sache der Äußerlichkeiten, der Konventionen, der Dichtung. Aber das hieße dann auch, dass es sich um eine Idee handelt, die ziemlich hartnäckig ist und in neuer Form immer wieder Renaissancen erleben kann. Wie heute.


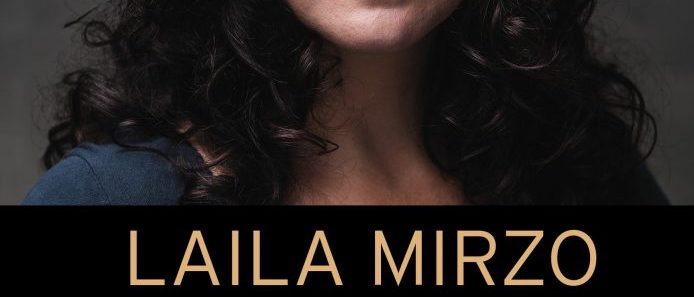
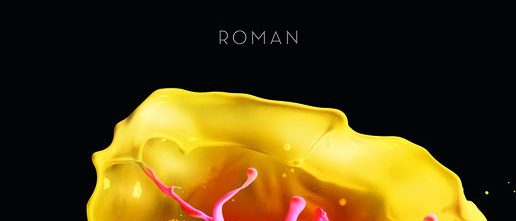










akinom
„Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde.“ Diese Worte der Messliturgie habe ich lange nicht verstanden. Dabei ist die babylonische Sprachverwirrung heute offenbar noch größer als in allen Diktaturen der Vergangenheit und Gegenwart. Wer immer diese entlarvt verdient nicht nur einen Nobelpreis!
Stefan Schmidt
Gestern im Handel gesehen. Heute Ihren Artikel gelesen, eben gekauft. :D
Das ist eigentlich untypisch für mich, normalerweise hätte ich erst einige Wochen über den Kauf nachgedacht (protestantische Sparsamkeit?), aber dieses Buch finde ich wichtig und interessant.
Das Thema treibt mich immer wieder um und auch mit Freunden rede ich andauernd darüber.
Ich bin gespannt auf die Lektüre, auch wenn es noch etwas dauern wird.
Zu den Zumutungen.
Natürlich ist jede höhere Tugend eine Zumutung, eine extreme Forderung.
Dem Einen fällt es leichter, dem Anderen schwerer, aber wichtig ist, finde ich, dass es bei einem tugendhaften Leben nicht darum geht alles immer einzuhalten und sofort zu beherrschen.
Es geht dabei vor allem um das Streben nach Ritterlichkeit und Tugendhaftigkeit.
Es geht auch im Christentum nicht darum nach der Taufe keine Sünde mehr zu begehen und sofort perfekt zu leben, sondern, danach zu streben nicht mehr zu sündigen, sein Leben immer mehr an Gott auszurichten.
Das ist ein Gedanke der vielleicht etwas verloren gegangen ist.
Man mag ob der Höhe der Forderung der Tugend verzweifeln und aufgeben, aber es ist eben wichtig zu sehen, dass das das Ziel ist und das Streben danach wichtig ist. Ich finde das macht es schon einfacher sich dem zu stellen.
akinom
Ein wunderbarer Kommentar! So evangelisch, wie Sie bin ich auch.
akinom
Bewusst liefert sich Alexander von Schönburg der Gefahr aus „als Anstandswauwau der Nation aufgespießt zu werden“. Im neuen „durchblick“ stellt er sein Buch vor in der Überzeugung: „Wir haben alles, was jemals galt in Frage gestellt. Jetzt ist es
langsam an der Zeit das Alles-in-Frage-stellen in Frage zu stellen.
Don
„ihr/ihm/x“ Nu, das „x“ hätts nun nicht gebraucht. Mit dieser Akzeptanz des „x“ als Standard stolpert der Autor selbst in die von ihm genannte Falle: „Aber was ist in uns gefahren, dass wir dieses Faktum, statt es zu bedauern, nun als Standard hinnehmen?“