
„Ich wollte Priester werden, um Pfarrer zu werden. Ich habe das Pfarrersein aufgegeben, um Priester bleiben zu können.“
Wenn ein Pfarrer „aussteigt“, weil er den Glauben verloren hat, weil er sich verliebt hat und heiraten will, oder weil er sich mit der Kirche aus anderen Gründen überwirft, dann ist das zwar für sein engeres Umfeld eine Katastrophe, für die Interpretation ist es allerdings einfach. Konservative Katholiken sehen dann darin eben den Glaubensabfall oder – je nach Situation – den Nachweis, dass der Betreffende eben keine Berufung zum Priestersein hatte. Kirchenkritiker und liberale Katholiken sehen sich in gleicher Situation in ihrem Weltbild gestärkt: Der Zölibat hat den Priester kaputtgemacht, kirchliche Strukturen verhindern ein gutes Priestersein.
Kein Ausstieg
Lassen sich Weltbilder auf diese Weise leicht ins Lot bringen, dann bleibt der neue Lebensabschnitt des Ex-Priesters für ihn selbst natürlich herausfordernd – ich setze dabei voraus, dass niemand den Schritt zur Priesterweise leichtfertig getan hat und ihm dann auch der Ausstieg nicht leichtfallen wird. Für das weitere Umfeld und die kirchliche Gesellschaft ist das Buch allerdings sehr schnell wieder geschlossen. Diesen Gefallen hat der Kirche Thomas Frings; Großneffe des bekannten Kölner Erzbischofs Kardinal Joseph Frings, 1987 zum Priester geweiht und viele Jahre Pfarrer, nicht getan. Er ist Priester geblieben, will Priester bleiben, sieht diese Möglichkeit aber als Pfarrer – in den gegebenen Strukturen – nicht gewährleistet.
Zeitgemäßheit
Also ein Stachel im Fleisch der Kirchenoberen, einer, der zwar einerseits aussteigt, aber nicht den Anstand besitzt, die anderen wenigstens in Ruhe zu lassen? Nein, so einfach ist es nicht. Und vor allem ist seine Aufgabe des Pfarrerseins nicht allein eine Frage von Hierarchiestrukturen, und schon gar keine der Lehre. Wer Frings Buch „Aus, Amen, Ende? – So kann ich nicht mehr Pfarrer sein“ liest kann zwar an der einen oder anderen Stelle durchaus auch eine Kritik an Lehrfragen interpretieren, das ist aber nicht der entscheidende Punkt.
Hier ist kein Priester, der Priester bleibt und trotzdem in einer eheähnlichen Beziehung leben will, keiner, der von der Kanzel Häresien verbreitet. Frings sieht einfach die historische Gemeindestruktur als nicht mehr zeitgemäß an.
Wie vor dreißig Jahren
Vielleicht würde er aber auch diese Formulierung ablehnen, denn es geht auch nicht um ein Hinterherjagen nach dem Zeitgeist, sondern um die Reaktion auf das, was ist: Wie sehen Gemeinden heute aus, wer ist da noch aktiv, was bedeuten Gemeindefusionen für die Kirche, für die Gläubigen aber auch für die Suchenden? Kann es sein, so fragt Frings, dass wir mit all den Plänen, die in den Bistumsverwaltungen geschmiedet und in Pastoralplänen dokumentiert werden, nur versucht wird, etwas zu erhalten, was man aus der Vergangenheit kennt? Kann es sein, dass das alles nur dem Wunsch entspringt, es möge doch bitte alles wieder so werden, wie vor dreißig Jahren?
Das Umfeld tut uns, die wir als Gläubige Kirche sin, aber nicht. Und die Kritik richtet sich daher nicht in erster Linie an die Kirchenoffiziellen sondern an alle Ebenen: Bischöfe, Verwaltung, Hauptamtliche, Priester, Diakone, Katecheten, und – ja auch – die Gläubigen, die es bitteschön auch gerne so halten möchte, wie sie es von früher kennen. Wenn sie denn schon noch in die Kirche gehen, dann soll die auch so sein, wie sie es gerne hätten. Soll „die Kirche“ doch froh sein, dass sie überhaupt noch kommen,
„Grandhotel Erstkommunion“
Und so sieht dann eben Pastoral und Liturgie auch aus. Frings berichtet aus seinem Pfarreralltag, und manches wird einem bekannt vorkommen, sieht man doch ähnliches in fast allen Gemeinden: Festhalten an Traditionen, oder besser an dem, wie man es schon immer gemacht hat. Die Kirche soll nah bleiben, sonst kommen die Menschen nicht mehr: Haben wir in den vergangenen Jahren die Menschen wirklich so wenig vom Glauben überzeugt, dass ein paar hundert Meter sie aus der Kirche treiben. Messzeiten sollten bitte so bleiben, wie sie sind, Abendmessen dürfen auf keinen Fall mit der Sportschau, Morgenmessen nicht mit ausgedehnten Frühstück kollidieren. Wie wichtig ist die Eucharistie eigentlich den Gläubigen … oder wie wird der Glaube dieser Menschen eigentlich von den Hauptamtlichen eingeschätzt.
Und wer das Kapitel „Grandhotel Erstkommunion“ liest und selbst gerade Kinder in der Kommunionvorbereitung hat, bei der seit Jahren das gleiche System gefahren wird mit der seit Jahren gleichen Konsequenz, dass weder die Eltern, geschweige denn die Kinder auf die eigentlichen Glaubensfragen wirklich Wert legen und sie konsequenterweise dann auch zu mindestens 90 % nicht mehr in der Kirche gesichtet werden, der mag sich beruhigt fühlen, dass es in anderen Gemeinden auch nicht schlechter läuft als in der eigenen.
„Die kleine Herde“ als bequeme Ausrede
Aber muss das so sein? Ist es wirklich der Weisheit letzter Schluss, sich mit einer „kleinen Herde“ zufrieden zu geben? Für manchen scheint das Wort der kleinen Herde eher eine Ausrede sein, um sich möglichst keine Gedanken über Änderungen machen zu müssen. Der Anspruch mancher Offiziellen und auch vieler Gläubiger an Glaubensinteressierte ist dabei hoch – unter Eucharistie geht nichts, wer sich nicht taufen lässt gehört nicht dazu, und wer seine Kinder nach der Taufe nicht im Glauben unterweist, ist eben selbst schuld.
Sich selbst kann man dabei in Sicherheit wiegen, geht man doch nicht das Risiko ein, irgendwo zu tief zu stapeln. Diesen Schuh muss ich mir selbst als Konservativer durchaus auch anziehen: Wo sind die Alternativen für Menschen, die Jesus näherkommen wollen, mit Sakramenten und Messfeier aber noch wenig anfangen können? Wo erfahren sie Zuspruch, ohne dass der Anspruch sie überfordert?
Sakramente oder nichts?
Was umgekehrt für Frings nicht bedeutet, den Anspruch an sich herunterzuschrauben. Wer wirklich Christ sein möchte, also Christus nachfolgen, der muss sich Jesu Ansprüchen stellen, die beispielsweise auch die Sakramente wiedergeben. Das aber erst nach einer Phase – oder lebenslang andauernden Phasen – der Annäherung. Was bringt es, wenn ein Paar direkt sakramental heiratet, dem Anspruch an die Ehe aber nicht gerecht werden kann, ihn vielleicht auch nicht versteht und ihn gar nicht erfüllen will? Gibt es keine Alternative?
Warum gibt es für Kinder nur die Option „Taufe oder nichts“, wenn doch die Eltern und Paten das dabei von ihnen geforderte Versprechen, die Kinder im Glauben zu erziehen, nicht erfüllen können … was sich dann leider erst wieder bei der Erstkommunion dokumentiert, wenn sie nicht wissen, wie man ein Kreuzzeichen macht und nicht ein einziges Gebet sprechen können?
Entscheidungsgemeinde … und die Benedikt-Option
Frings Vorschlag ist der einer „Entscheidungsgemeinde“ imGegensatz zu einer Flächengemeinde. Die Türen solcher Gemeinden sollten offensein, jeder der danach sucht, findet hier Zuspruch, wer aber dazu gehören will,für den wächst der Anspruch an sein eigenes Leben. Christ sein hat mit Missionzu tun, hat auch mit Sakramenten zu tun, die wiederum nicht leichtfertiggespendet werden sollten. Das von Frings im finalen Kapitel seines Buchesskizzierte Bild einer solchen Gemeinde erscheint mir auf beinahe erschreckendeArt kompatibel mit dem, was auch in der Benedikt-Option beschrieben ist. Wo man dieser die Kritik entgegenbringen könnte, sich zu sehr der Welt zuverschließen, reißt die Entscheidungsgemeinde die Türen weit auf, ohne deninneren Anspruch, den Anspruch an die Kirchengemeinde selbst herunter zuschrauben.
Erschreckend ist das deshalb, weil ich an allen Ecken und Enden derzeit Bestrebungen sehe, die Kirche in dieser Art neu zu positionieren: Nicht die Inhalte, aber – da wo sie nicht zwingend vorgegeben ist – die Form. Eine solche Kirche hätte dem formalen Anschein nach wenig gemein mit den Flächengemeinden, könnte aber deutlich anziehender sein für diejenigen, die sich auf den Weg machen wollen, Christus zu folgen.
Mut
Was es dazu baucht ist Mut. Natürlich kann eine solche Gemeindegründung scheitern, aber wäre es nicht sträflich, es nicht wenigstens zu versuchen? Und wie zum Nachweis, dass es hier nicht um eine neue Lehre geht, beschreibt Frings den Mut mit den Worten „mit der Heiligen Schrift in der Hand, mit zweitausend Jahren Geschichte, in Verbindung mit Bischof und Papst Orte des Glaubens neu ins Leben [zu] rufen.“
Bewegung in der Kirche
Es ist Bewegung in der Kirche. Nicht in der Lehre, wie manche, auch Bischöfe, das gerne hätten, um den quantitativen Status Quo aufrecht zu erhalten (als ob eine solche „abgestrippte“ Kirche irgendeine Anziehungskraft haben könnte im Wettbewerb mit anderen „Wellnessangeboten“). Aber die Bewegung liegt in den neuen oder von mir aus auch wiederentdeckten Formen von Mission, Pastoral und Gemeindeleben. Dazu gehören neben der Idee der Entscheidungsgemeinde und der Benedikt-Option auch Initiativen wie das Augsburger Gebetshaus oder das in dessen Umfeld entstandene Mission Manifest. Der Anspruch, den wir – als Mitglieder der Kirche, die das auch bleiben wollen – an uns haben müssen ist der, diese Bewegungen zu fördern, uns einzubringen oder ihnen . wenn schon sonst nichts – zumindest nicht im Wege zu stehen.
Die Kirche kann ihrer rein äußerlichen Form nicht mehr werden, wie sie vor dreißig Jahren war – und das ist vermutlich auch gut so. Das bedeutet aber, dass wir jetzt gefordert sind, die äußere Form jetzt, immer wieder neu, zu prägen. Nur so gelingt der Spagat, die Türen für die Welt zu öffnen, ohne sich der Welt anzupassen.


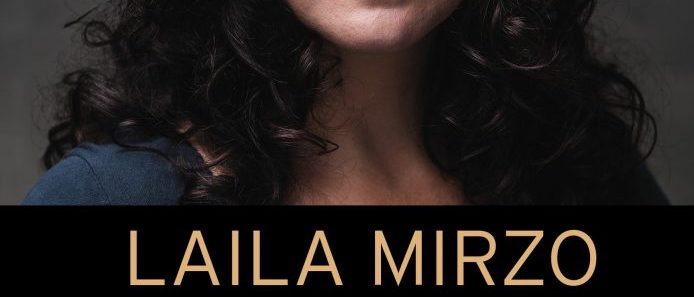
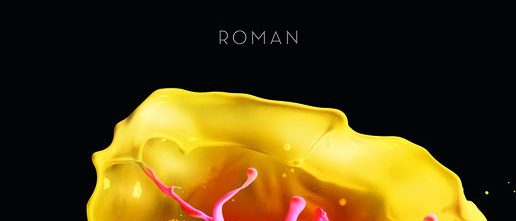










akinom
Wie vor 30 Jahren? Ich lese gerade das Buch von Heinz Brathe und Bernhard Frings einem Namensvetter von Thomas und Kardinal Joseph Frings, der mich gefirmt hat. Der Titel des Buches: „Lebendige Gemeinde – 1200 Jahre St. Viktor in Dülmen“. Wie vor 30 Jahren ist es in dieser Gemeinde nie gewesen, nicht in der Frühzeit, nicht in den Wirren des 16. Jahrhunderts, nicht in der Säkularisation, nicht zu Lebzeiten der seligen Dülmener stigmatisierten Mystikerin Anna Katharina Emmerich, nicht im Kulturkampf und zur Zeit der Industrialisierung, nicht im und nach dem 1. Weltkrieg, nicht im 3. Reich und im 2. Weltkrieg, nicht nachdem Dülmen 1945 so total wie Dresden den Bomben zum Opfer gefallen ist, nicht in den Jahren des „Wirtschaftswunders“ und auch nicht heute, wo das Seligsprechungsverfahren des Dülmener Andenmissionars Bischof Friedrich Kaiser eingeläutet ist, der 1963 in St. Viktor zum Bischof geweiht worden ist. Unser junger Stadtdechant Markus Trautmann hat jetzt gerade einen Tourenbegleiter durch NRW veröffentlicht, in dem er zu Fuß, per Fahrrad und per Bahn allein und mit Gemeindemitgliedern den Spuren Kaisers gefolgt ist. Wallfahrten haben immer eine große Rolle in der Gemeinde gespielt…
Als wir noch in Essen wohnten pflegte ich zu sagen: „Ich bin Gemeinde evangelisch und Kirche katholisch.“ So kann ich den Schritt von Thomas Frings wirklich sehr gut verstehen und habe Hochachtung vor seinem mutig beschrittenen Weg seines Priestertums. Ich war damals jahrelang im Bibelkreis des engagierten evangelischen Pastors Martin Quaas und habe von seiner guten „geistigen Kost“ viel profitiert. In seinem „Segnungsseminar“ habe ich mir bis heute immer mehr angewöhnt, alle Menschen zu segnen, die mir begegnen.
Ich bin im Leben viel umgezogen und hatte mich nie als Gemeindemitglied gefühlt. Das ist heute in St. Viktor anders, auch wenn ich aus gesundheitlichen Gründen (fast) nur noch an Vorabendmessen in einem Seniorenstift teilnehmen kann, wo die hl Messe nur im Sitzen mitgefeiert werden kann und die guten kurzen Predigten akustisch sehr gut zu verstehen sind. Deo gratias!
akinom
„Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“ Unter dem Leitwort von Psalm 18.30 liegt in St. Viktor ein Gebetszettel „für ein gutes Gelingen der Gemeindefusion“ nicht nur am Schriftenstand. Es liegt auch den Gebetbüchern bei und wird häufig gemeinsam gebetet. Ich möchte es hier anfügen:
Herr, Jesus Christus,
wir sind deine Kirche hier am Ort,
wir sind ein Volk, unterwegs zu einer neuen Zeit.
Lass in uns und unseren Gemeinden
deine Gnadengaben lebendig werden.
Sende uns Deinen Heiligen Geist
damit wir zuhören können,
damit wir Frieden suchen und
uns nach Gemeinschaft im Glauben sehnen.
Sende uns deinen Heiligen Geist,
dass wir es schaffen zu versöhnen,
damit wir mutig genug werden,
um für dich Zeugnis abzulegen.
Lass uns offen sein für einen neuen Weg zu dir,
auch, wenn er uns manchmal ungewohnt und fremd vorkommt.
Herr, hilf uns, das wir Gutes bewahren und Neues wagen.
Nur durch dich sind wir Kirche.
Deine sanfte und sichere Hand leite uns,
dass wir eine neue Gemeinschaft werden
in Dülmen Stadt und Land.
Lass uns spüren:
Du bist bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt.
Amen
Ich denke, dieses Gebet passt zum Blogbeitrag und sollte auch über „Dülmen Stadt hinaus verbreitet werden. Auf dem Gebetszettel werden dann auch noch die Pfarrpatrone der fusionierten Gemeinden mit Fürbitten angerufen.
Ich frage mich, was Thomas Frings getan hätte, wenn das Gebet in seiner Gemeinde gebetet und erhört worden wäre. Möge sein jetziger Weg reiche Frucht bringen!
Claudia Sperlich
Dann sollen sie doch kommen, die Christen, die mit den Sakramenten noch nicht so viel anfangen können.
Dann sollen sie doch nicht zu ihrem TaiChi-Kurs hoppeln, wenn sie von der Arbeit gestresst sind, sondern zum Rosenkranzgebet (bei uns jeden Samstag).
Dann sollen sie doch nicht verbreiten, daß „die Kirche ja doch keine echten Antworten hat“, solange sie nicht zum Bibelkreis und zu Glaubensgesprächen für Erwachsene kommen (bei uns jeweils einmal im Monat).
Dann sollen sie doch nicht ihren mit strahlenden Gesichtern und solidem Wissen über die Vollzüge als Ministranten dienenden Kindern sagen, es sei jetzt mal gut mit Ministrieren, die Familie gehe vor.
Dann sollen sie doch nicht behaupten, es sei immer alles so uninteressant, und sämtliche Vorträge und Filmabende ignorieren (die bei uns wegen mangelndem Interesse selten geworden sind).
Wer Kirche will, muß hingehen. Oder halt die Schnauze halten, pardon, ich bin gereizt und kann es nicht netter sagen.
Absalon von Lund
Viele Priester sagen das, was Thomas Frings sagt. Die Verwaltung frißt den Priester auf. Das Problem ist die schwarzgraue flache Aktenmappe des Prälaten, die ihn NUR in Deutschland zu 99% als Staatsbeamten ausweist und nur sein Collarkragen läßt ihn als katholischen Preister erkennen. Das Verhältnis 99:1 bleibt leider. Keine Zeit für Seelsorge!
Meine eigene Erfahrung nach Jahrzehnten des Geschwätzes der Welt: in der Kirche möchte ich mit Gott sprechen und ihn hören, nicht mit anderen über ihn diskutieren. Das geht in aller Stille. Nur drei Dinge sind notwendig: Gebet, Beichte und Eucharistie. Hörende Maria-Kirche, nicht Martha-Kirche. Kirche ist nie zeitgemäß, weil Ewigkeit keine Zeit kennt. Es gibt auch nicht den Markt der Möglichkeiten, es gibt immer nur einen Befehl Gottes aus unendlich vielen Bausteinen und der ist richtig. Auch Computerprogramme funktionieren mit streng logischen Befehlen, nicht mit Diskussionen. Das Reich Gottes „funktioniert“ also STRENG hierarchisch in der Vertikalen ohne Diskussion in der Horizontalen. Deshalb wendet sich der Hauptmann von Kafaraum an Jesus. Er weiß um dieses Prinzip und der Diener wird gesund. Es ist der absolute Gehorsam Jesu gegenüber dem Vater, der das bewirkt. Diesen Gehorsam hat uns Jesus am Kreuz gezeigt, sonst hätten wir keine Zukunft! Maßnahmen in Deutschland: Tempelreinigung! Raus mit den Händlern und Geldwechslern. Man kommt nicht drum herum: umgehende Trennung von Kirche und Staat! Bildet das Reich Gottes in der Kirche ab. Es ist supereinfach, aber es erfordert absoluten strengen Gehorsam. Das Tor zum Himmel ist sehr schmal (Gehorsam), der Weg ins Verderben sehr breit (Diskussion). Die Zusammenfassung aller Theologie ist das JA der heiligen Bernadette. Wenn man es so macht, verschwindet die Aktenmappe des Prälaten, Fürst Bismarck ärgert sich sehr, das Verhältnis Verwaltung zu Seelsorge ändert sich auf 1:99 (im Himmel dann keine Verwaltung mehr). Macht es einfach so, wie man es macht! Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen!
gerd
„Ist es wirklich der Weisheit letzter Schluss, sich mit einer „kleinen Herde“ zufrieden zu geben?“
Nun, folgt man den Worten des Herrn ist es ausschließlich die „kleine Herde“, die sich nicht zu fürchten braucht. Von einer „großen Herde“ sagt Jesus nichts. Warum? Ich meine: Weil es die schlichtweg nicht gibt, nie gegeben hat und nicht geben wird. Wir müssen uns endlich damit auseinander setzen, dass es sehr viele Menschen gibt (sozusagen eine große Herde) die mit Jesus, seinem Evangelium und mit den Sakramenten die er gestiftet hat nichts am Hut haben wollen, die es ablehnen sein Joch auf sich zu nehem oder gar ihr Kreuz mit ihm tragen wollen. Nun denn, Jesus hindert niemanden daran ihm nicht nachzufolgen. Er setzt dem ganzen noch die Krone auf, indem er seine engen Freunde, sozusagen die ersten Mitglieder der kleinen Herde auffordert: „Wollt auch ihr weg gehen?“
Die Leere in den Kirchen und das Übermaß an Strukturen in derselben, können nur aufrecht erhalten werden, wenn man den Menschen vorgaukelt, dass irgendwie alle gerettet werden, weil Gott ja alle Menschen so lieb hat und wir brav die Kirchensteuer bezahlen.
Dieses zusätzliche Gerede im Stil von, die Menschen da abholen wo sie sind, an die Ränder gehen, den Geruch der Schafe annehmen oder die Lebenswirklichkeit der Menschen wahrnehmen, sind höchstens gut gemeinte Floskeln, die mit der Kernbotschaft des Evangeliums (Umkehr) nur bedingt oder gar nichts zu tun haben. Ein „guter“ oder „schlechter“ Katholik ist man weder in einer Flächengemeinde, noch in einer Entscheidungsgemeinde. (Entscheidungen in der Fläche sind so schlecht ja auch nicht) Schon gar nicht in einer sog. Volkskirche, der man ja scheinbar immer noch nachtrauert und als Ideal anbetet. Ein guter oder schlechter Mensch ist man immer alleine(!) vor Gott. Alles in unserem Leben läuft auf den Moment hinaus, wo wir unser persönliches Gericht vor dem Herrn bestehen müssen. (Beichte kann die Sache abkürzen) Um dieses halbwegs bestehen zu können, müssen wir die Wahrheit kennen. (Verkündigung) Dann müssen wir die Wahrheit annehmen (Gehorsam) und aushalten (Nachfolge). Als Priester muss Herr Frings aushalten, dass er abgelehnt, verspottet und gekreuzigt wird. Er muss aushalten, dass er in die besondere Nachfolge des Herrn berufen ist, die nichts mit der Nachfolge der Laien zu tun hat. Das kann er in der Flächengemeinde genauso gut oder schlecht wie in der Entscheidungsgemeinde. Seine Verantwortung ist erst mal größer als die des „normal“ Getauften. Wir sollen uns freuen und jubeln, wenn wir den Weg des Herrn bis zum Kreuz geduldig gehen, weil unser Lohn im Himmel groß sein wird. Desweiteren sollen wir zur Kenntnis nehmen, dass es den Ort gibt, wo das Feuer nie erlischt und der Wurm nagt. Und das dieser Ort mitnichten so leer sein wird, wie wir denken.